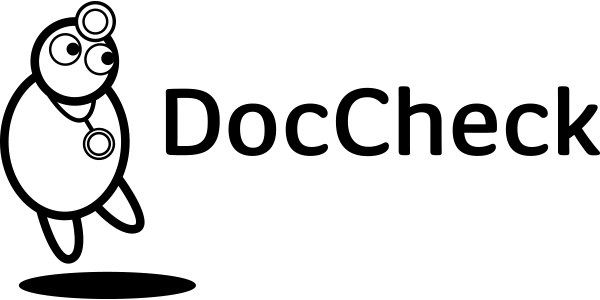Inaktivierte Viren für die Impfstoffentwicklung
GSI/FAIR und HZI kooperieren im Kampf gegen das Coronavirus
Das GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung und die FAIR GmbH (GSI/FAIR) setzen ihr Forschungspotenzial und ihre einzigartige Infrastruktur ein, um zur Bewältigung der aktuellen Corona-Pandemie beizutragen. In mehreren Bereichen von GSI/FAIR arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler daran, neue Erkenntnisse und Technologien zu liefern, die bei der Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 helfen können. Gemeinsam mit dem Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI) in Braunschweig werden Methoden zur Inaktivierung der Viren erprobt. Diese kommen bei der Impfstoffentwicklung zum Einsatz. Dazu werden auch die Beschleuniger und Labors auf dem Darmstädter Campus genutzt. Die Anlagen sind in Betrieb, wobei die Sicherheitsvorschriften strikt eingehalten werden.
Vier Projekte werden aktuell ausgearbeitet, um die Möglichkeiten der GSI/FAIR-Forschung in der Corona-Krise auszuschöpfen und das grundlegende Wissen über das Virus zu erweitern. Die Forscherinnen und Forscher arbeiten dabei ebenso an Beiträgen zur Entwicklung von Impfstoffen wie zu therapeutischen Bestrahlungsmöglichkeiten von durch SARS-CoV-2 ausgelösten Lungenentzündungen. Andere Projekte zielen auf die Entwicklung einer schnelleren und optimierten Viruserkennung und auf die Möglichkeit, verbesserte Virusfiltermasken herzustellen.
Dabei kooperiert GSI/FAIR wie gewohnt mit anderen Forschungszentren: Eine der Maßnahmen betrifft eine Zusammenarbeit mit dem Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI) in Braunschweig, eine andere findet in Kooperation mit den Universitätskliniken in Frankfurt und Erlangen statt. Zwei weitere Projekte werden in Zusammenarbeit mit Universitäten in den USA und Argentinien sowie dem Universitätsklinikum Gießen-Marburg und der Firma TransMIT GmbH in Gießen entwickelt.
Übersicht über die vier Projekte:
- Ionen-Bestrahlung für die Impfstoffentwicklung
Um Impfstoffe mit inaktivierten Viren zu entwickeln, benötigen Forscherinnen und Forscher Methoden, die zwar das Virus inaktivieren, seine Struktur – insbesondere die für die Immunantwort entscheidende Virushülle – aber möglichst wenig beschädigen. In den vergangenen Jahren wurde die Inaktivierung von Viren für die Impfstoffentwicklung mit konventioneller Gamma-Strahlung durchgeführt. Der Einsatz hoher Gammastrahlendosen führt jedoch unweigerlich zu einer Schädigung der Struktur- und Membran-assoziierten Proteine des Virus, die nach der Impfung vom Immunsystem erkannt werden sollten, um einen effizienten Schutz zu bieten. Das neue Projekt sieht deshalb vor, Influenza- und SARS-CoV-2-Viren mit hochenergetischen Schwerionen zu bestrahlen. Energetische Ionen sind in der Lage, das Virus zu inaktivieren, indem sie mit nur wenigen Durchgängen in der Hülle Brüche in der viralen RNA induzieren und zugleich die Membranschäden minimieren. Die daraus resultierenden Viren werden anschließend am HZI auf ihre Fähigkeit hin untersucht, die Bildung von virusbindenden und neutralisierenden Antikörpern nach der Impfung zu fördern. - Therapeutische Wirkung von Niedrigdosisbestrahlungen bei durch SARS-CoV-2 induzierten Lungenentzündungen
In einer präklinischen Studie wollen die GSI-Forscherinnen und -Forscher prüfen, ob eine durch SARS-CoV-2 ausgelöste Lungenentzündung mit einer niedrig dosierten Bestrahlung behandelt werden kann. Partner hierbei sind die Universitätskliniken in Frankfurt und Erlangen. Dazu sollen die entzündungshemmenden Effekte in der Lunge unter zwei Alternativbedingungen verglichen werden: Zum einen beim Einsatz einer typischen Niedrigdosis-Röntgenbestrahlung, wie sie bereits in der Vergangenheit zur Behandlung von Lungenentzündungen verabreicht wurde, zum anderen beim Einsatz einer erhöhten Radonaktivität im Vergleich zur natürlichen Aktivität. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wollen Erkenntnisse darüber gewinnen, in welchem Stadium der Krankheit dies ein geeigneter Weg sein könnte. Außerdem gilt es, eine Balance zu finden zwischen gewünschter entzündungshemmender Wirkung in der Lunge und ungewünschter immunsuppressiver, systemischer Wirkung der Strahlung. Hier könnte die Chance für eine Radonexposition als moderater Immunmodulator liegen. - Verbesserte und schnelle Viruserkennung mit Einzelnanoporen-Membranen
GSI arbeitet mit internationalen Partnern an der Entwicklung von hochempfindlichen Sensoren auf Nanoporen-Basis. Diese haben das Potenzial, Viren wie SARS-CoV-2 gezielt und schnell nachzuweisen. Dazu bieten Membranen mit einzelnen Nanoporen hervorragende Nachweisbedingungen. An den GSI-und FAIR-Beschleunigeranlagen können Polymerfolien mit einzelnen Ionen bestrahlt werden. Durch chemisches Ätzen der Ionenspur entsteht ein Nanokanal, dessen Geometrie und Durchmesser sehr genau eingestellt werden können. In Kooperation mit externen Gruppen wird die Oberfläche der Nanoporen gezielt funktionalisiert, um den Transport spezifischer Partikel, Moleküle oder auch Viren durch die Nanopore nachzuweisen. Sensoren auf Nanoporen-Basis haben das Potenzial für eine hohe Empfindlichkeit und schnelle Nachweisreaktion. Gemeinsam mit den Kollaborationspartnern werden derzeit Möglichkeiten zur Unterstützung von Forschungsprojekten zum Nachweis von Viren wie SARS-CoV-2 oder spezifischen Filtrationsprozessen unter Verwendung der spurgeätzten GSI-Membranen untersucht. - Ionenspur-Membranen mit maßgeschneiderten Nanoporen für Virusfiltermasken
In diesem Projekt ist geplant, Nanoporen aus geätzten Ionenspuren zu nutzen, um spezielle Filter zu entwickeln und damit Virus-Atemschutzmasken zu verbessern. Bei GSI werden entsprechende Polymerfolien mit monodispersen und orientierten Nanoporen durch Ionenbestrahlung und anschließendes chemisches Spurätzen hergestellt. Der Porendurchmesser kann dabei genau zugeschnitten werden. Mit einem einstellbaren Durchmesser von bis zu 20 Nanometern sind solche Nanoporen deutlich kleiner als die Größe des Coronavirus SARS-CoV-2. Der Bestrahlungsprozess an der GSI-Beschleunigeranlage erlaubt es zudem, die Anzahl der Nanoporen genau einzustellen (bis zirka 10 Milliarden pro cm2). Gemeinsam mit den Kollaborationspartnern diskutieren die GSI-Wissenschaftlerinnen und -Wissenschaftler derzeit Möglichkeiten, um die Eignung und die optimalen Parameter von spurgeätzten Membranen als Filter für Atemschutzmasken zu untersuchen. Auf diese Weise optimierte Atemschutzmasken könnten in Pandemie-Situationen besser vor einer Virusinfektion schützen.
Diese Pressemitteilung mit druckfähigen Fotos finden Sie hier.