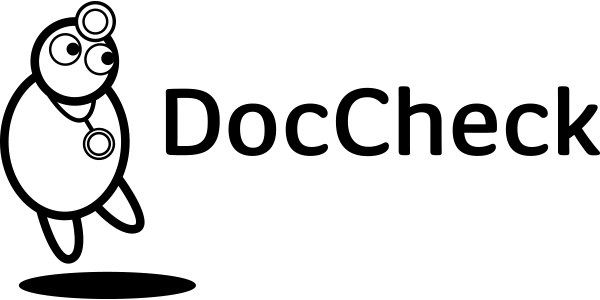Stellungnahme zum Artikel im Ärzteblatt vom 14.1.25 zum Nutzen von Neurofeedback-Behandlungen bei ADHS
Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Biofeedback (DGBfb e.V.) zum Artikel im Deutschen Ärzteblatt vom 14.01.2025: “Kaum Belege für einen Nutzen von Neurofeedback-Behandlungen bei ADHS“
Mit Interesse haben wir, der Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Biofeedback, die Berichterstattung des Ärzteblatts zur Studie von Westwood et al. (2024) aus JAMA Psychiatry verfolgt. Sowohl in Bezug auf diese und weitere Studien als auch aus langjähriger therapeutischer Erfahrung heraus können wir die Schlussfolgerung, die die Überschrift des Artikels suggeriert, nicht teilen. Neurofeedback zeigt u.E. durchaus einen signifikanten und wissenschaftlich belegten Nutzen in der Behandlung von ADHS.
Zur Studie im Detail: Die im Ärzteblatt referenzierte Studie von Westwood et al. (2024) aus JAMA Psychiatry berichtet Ergebnisse einer Meta-Analyse auf Basis von 38 randomisiert-kontrollierten Studien zu Neurofeedback als Behandlung bei ADHS. Analysiert werden hier ausschließlich Ergebnisse von Studien, welche die ADHS-Kernsymptomatik durch „wahrscheinlich verblindete Beurteiler“ erfassten. In den meisten Fällen sind dies Lehrkräfte. Zusätzlich wurden Studien untersucht, die Effekte von ADHS auf neuropsychologische Hirnleistungsparameter erfassten. Effekte wurden ausschließlich im gemittelten Gruppenvergleich zu verschiedenen Kontrollgruppen (z.B. Wartegruppen, „Treatment as usual“, medikamentös behandelte Gruppen und andere aktive Kontrollgruppen) erfasst.
Bei der Berechnung der Effektstärken im Rahmen der Studie wurden jedoch auch einige Befunde nicht berücksichtigt, z.B. solche die a) innerhalb einzelner Individuen im Verlauf auftreten (individuelle Verbesserungen auf Personenebene), b) Studien, bei denen die Bewertung der ADHS-Symptomatik durch Personen (z.B. Eltern) mit deutlich umfassenderem Einblick in die Lebenswelten der behandelten Kinder erfolgt, c) Studien, welche sich mit anderen Outcomes außerhalb der Kernsymptomatik der ADHS befassen (z.B. Verbesserung von Schulleistungen, Verbesserung der Lebensqualität etc.) d) teilweise Studien zu Langzeiteffekten, da hierzu oft keine Beurteilung der ADHS-Symptomatik durch verblindete Beurteiler (Lehrkräfte) vorliegt.
Bereits aus früheren Meta-Analysen (z.B. Riesco-Matías et al., 2019) ist bekannt, dass die kalkulierte Effektivität von Neurofeedback stark von den Ein- und Ausschlusskriterien der jeweiligen Meta-Analyse abhängig ist und je nach Beurteiler und Bezugspunkt des Vergleichs (Personenebene oder Gruppenebene) in den Aussagen über die
Effektivität variiert.
Nichtsdestotrotz findet die hier beschriebene Meta-Analyse von Westwood et al. (2024) auch auf Gruppenebene und bei wahrscheinlich verblindeten Beurteilern bei der Anwendung von Standardprotokollen (z.B. Theta/Beta, SMR/Theta) signifikante Effekte von Neurofeedback auf die Gesamtsymptomatik bei ADHS (S. E4) sowie generelle signifikante Effekte auf die neuropsychologisch gemessene Verarbeitungsgeschwindigkeit (S. E8).
Die Autoren wenden in ihrer Meta-Analyse ein methodisch strenges Vorgehen nach dem State-of-the-Art der Durchführung von Meta-Analysen an, welches jedoch den generellen Einschränkungen von Meta-Analysen unterliegt. So können auf Basis der zugrundeliegenden Studiencharakteristika z.B. keine Aussagen über Langzeiteffekte getroffen werden, unter anderem, weil die verblindeten Lehrerurteile zur ADHS-Symptomatik meist nur kurz nach der Behandlung erfasst wurden (S. E8). Die signifikanten Effekte auf die neuropsychologische Verarbeitungsgeschwindigkeit hingegen zeigten sich auch langfristig, werden von den Autoren aber trotz der signifikanten Befunde als vermutlich klinisch wenig relevant bewertet, obwohl sie selbst eingestehen, dass diese eine Auswirkung auf die Kernsymptomatik der ADHS haben können (S. E8).
Wie die Autoren selbst betonen, sind die Ergebnisse der randomisiert-kontrollierten Studien auf dem aggregierten Gruppenlevel z.B. nicht vergleichbar mit einem individualisierten Training in der Praxis (S. E9). Zusätzlich ist für ein Gesamtbild der Evidenzlage darauf hinzuweisen, dass in dieser Meta-Analyse aufgrund der strengen Auswahl der Beurteilungsmaße (nur Lehrerurteil und neuropsychologische Messungen) 38 Studien eingingen, während z.B. Moreno-García et al. (2022) in einer systematischen Übersichtsarbeit von 165 klinischen Studien (davon 67 randomisiert-kontrollierte Studien) ein deutlich positives Bild zur Evidenz, gerade in Hinblick auf die Langzeiteffekte von Neurofeedback bei ADHS zeigten.
Weiterhin sei gesagt, dass dies nicht das erste Mal ist, dass in den vergangenen Jahren aus akademischer Sicht Zweifel am Nutzen des Neurofeedback in der Behandlung diverser Störungen, unter anderem auch bei ADHS, geäußert wurden. Genauso zahlreich, aber nicht in dieser Form im Ärzteblatt präsent, gibt es allerdings auch wissenschaftliche Nachweise der Wirksamkeit.
Darüber hinaus steht die Meldung im Ärzteblatt in einem starken Kontrast zu den Erfahrungen, die niedergelassene Neurofeedback-Therapeutinnen und -Therapeuten fast täglich machen: Hier werden deutliche Veränderungen im Aufmerksamkeits- und Selbstregulationsverhalten der behandelten Klienten registriert und auch von diesen berichtet.
Einer der Hauptunterschiede zwischen dem Vorgehen im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie und der Anwendung des Neurofeedbacks in einer niedergelassenen Praxis liegt sicherlich in der deutlich individualisierten Herangehensweise. Entsprechend den Ausbildungen, die durch die DGBfb oder auch von der Akademie für Neurofeedback in Deutschland vermittelt werden, geht es hier darum, „Klienten-gerechte“ individuelle Therapie- und Trainings-Bedingungen zu schaffen. Das heißt: Den Klienten und Patienten wird nicht nur vermittelt, wie im Rahmen einer Trainingssitzung Einfluss auf die elektrische Aktivität des Gehirns genommen werden kann, sondern auch, wie dies im Alltag konkret angewendet werden kann.
Eine weitere Begründung für den Unterschied zwischen der wissenschaftlich nachgewiesenen Wirksamkeit und den alltäglichen Erfahrungen in niedergelassenen Praxen kann auch darin liegen, dass der Aspekt der Wahrnehmung der eigenen Befindlichkeit in wissenschaftlichen Arbeiten sehr wenig thematisiert wird. Kurzer Zeitsprung in die Anfänge des Neurofeedback: In den ersten Studien von Kamiya (1962) wurden Personen eben nicht gebeten, ihre elektrische Hirntätigkeit zu verändern, sondern sie wurden darin trainiert, diesen Zustand, genauer die Alpha-Frequenz, wahrzunehmen. Nach kurzer Trainingsphase gelang das den Probanden dieser Studien auch in einem statistisch signifikanten Ausmaß.
Ein Beispiel aus der praktischen Arbeit mit einem ADHS-Klienten mag das noch einmal verdeutlichen. Befragt, worin denn der Unterschied in seinem Verhalten vor und nach dem Neurofeedback-Training (25 Sitzungen) liege, antwortete der damals 14-jährige Klient: „Früher habe ich erst bemerkt, wenn es am Ende der Schulstunde wieder klingelte, da wurde mir dann bewusst: Ich habe eigentlich die ganze Schulstunde geträumt, vielleicht mit Ausnahme der ersten fünf Minuten. Nun bemerke ich, wenn ich dabei bin, mich wegzuträumen. An der Stelle kann ich mich dann entscheiden, ob ich mich wegträume oder den Lehrern zuhöre“. Da im Rahmen des Trainings auch Methoden vermittelt wurden, wie die Aufmerksamkeit, in diesem Fall auf die Lehrpersonen, gehalten werden kann, erfolgte hier eine deutliche Verhaltensänderung und Besserung der ADHS-Symptomatik.
Nicht zuletzt ist auch aus einer klinischen Perspektive zu betonen, dass Gruppendaten aus wissenschaftlichen Studien, deren Behandlungsdauer aus Zeit- und Kostengründen oft auf 20-30 Neurofeedbacksitzungen beschränkt ist, nicht immer ein realistisches Bild langfristiger Lernprozesse in der Praxis abbilden.
Während wir uns als DGBfb e.V. über die kritische Betrachtung eines unserer Kernanwendungsfelder freuen und zustimmen, dass hier noch viel genauere und methodisch hochwertigere Forschung notwendig ist, sollte man das „Kind nicht mit dem Badewasser“ ausschütten, gerade vor dem Hintergrund der zahlreichen positiven Langzeiteffekte in der Praxis und in den Familiengefügen.
Der Vorstand der DGBfb
Weitere Informationen:
https://dgbfb.de/2025/02/stellungnahme-vom-vorstand/ Diese Mitteilung auf der Website der DGBfb e.V.