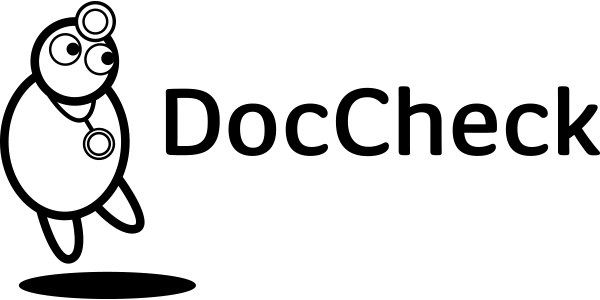Übergewichtig und gesund
Körpergewicht und Body-Mass-Index alleine sagen zu wenig darüber aus, ob jemand an Stoffwechselstörungen erkranken wird. Ein neuer Atlas über Zellen im Fettgewebe könnte nun helfen zu entschlüsseln, warum manche übergewichtigen Menschen gesund bleiben und andere nicht.
In Kürze:
- Forschende erstellten einen detaillierten Atlas über Veränderungen in Zellen von übergewichtigen Menschen.
- Der Atlas eignet für die Suche nach biologischen Indikatoren, die eine Aussage über das Risiko erlauben, eine Stoffwechselkrankheit zu entwickeln.
- Er könnte ausserdem Unterschiede bei der Entstehung von Stoffwechselerkrankungen zwischen Männern und Frauen erklären.
Wer stark übergewichtig ist, hat zwar ein grösseres Risiko für Diabetes, Bluthochdruck oder einen erhöhten Cholesterinwert. Aber nicht alle übergewichtigen Personen entwickeln solche Stoffwechselerkrankungen. Rund ein Viertel aller stark Übergewichtigen ist gesund, und die Wissenschaft versucht herauszufinden, warum manche Übergewichtige krank werden und andere nicht.
Eine umfassende Studie von Forschenden aus Zürich und Leipzig liefert dafür nun wichtige Grundlagen: Die Forschenden erstellten einen detaillierten Atlas mit Daten von gesunden und kranken übergewichtigen Menschen, zu ihrem Fettgewebe und zur Genaktivität in den Zellen dieses Gewebes. «Unsere Ergebnisse eignen sich für die Suche nach zellulären Markern, die etwas über das Risiko für Stoffwechselerkrankungen aussagen», erklärt Adhideb Ghosh. Er ist Oberassistent in der Gruppe von ETH-Professor Christian Wolfrum und einer der beiden Erstautoren der Studie. «Ausserdem sind die Daten für die Grundlagenforschung sehr interessant. Sie könnten helfen, neue Therapien gegen Stoffwechselkrankheiten zu entwickeln.»
Grosse Biomaterialbank untersucht
Für diese Studie nutzten Ghosh und seine Kolleg:innen die «Leipzig Obesity Biobank», eine umfangreiche Sammlung von Biopsien fettleibiger Personen. Wissenschaftler:innen der Universität Leipzig haben diese Biopsien zusammengetragen. Sie stammen von übergewichtigen Patient:innen, die sich chirurgischen Eingriffen unterzogen und zugestimmt haben, dass Ihnen Fettgewebeproben für Forschungszwecke entnommen werden. Die Sammlung enthält ausserdem umfangreiche medizinische Angaben zur Gesundheit der Patient:innen.
Die Gewebeproben stammten alle von stark Übergewichtigen mit oder ohne Stoffwechselerkrankungen. Sie erlauben also einen Vergleich zwischen gesunden und kranken Übergewichtigen. In Proben von 70 Freiwilligen untersuchten die Forschenden an der ETH Zürich Zelle für Zelle, welche Gene darin wie aktiv sind. Sie machten dies für zwei Arten von Fettgewebe: das Unterhaut- und das Viszeralgewebe.
Wissenschaft und Medizin gehen davon aus, dass vor allem das tief in der Bauchhöhle liegende Viszeralfett, das die inneren Organe umgibt, für Stoffwechselerkrankungen verantwortlich ist. Das direkt unter der Haut liegende Fett hingegen halten Expert:innen im Allgemeinen für weniger problematisch.
Für die Studie war es entscheidend, nicht einfach alle Zellen des Fettgewebes in einen Topf zu werfen. Denn Fettgewebe besteht nicht nur aus Fettzellen, sondern auch aus anderen Zellen. «Die Fettzellen sind sogar in der Minderheit», erklärt Isabel Reinisch, Postdoc in Wolfrums Gruppe und die zweite Erstautorin der Studie. Ein grosser Teil des Fettgewebes besteht aus Immunzellen, Zellen, die Blutgefässe bilden, sowie aus unreifen Vorläuferzellen der Fettzellen. Eine weitere Art von Zellen, sogenannte Mesothelzellen, kommen nur im Viszeralfettgewebe vor und grenzen dieses gegen aussen hin ab.
Bauchfett umorganisiert
Wie die Forschenden zeigen konnten, sind die Zellen im Viszeralfettgewebe von Menschen mit Stoffwechselerkrankungen funktionell stark verändert. In diesem Gewebe ist fast jeder Zelltyp von dieser Umorganisation betroffen. Die Genanalysen zeigten beispielsweise, dass die Fettzellen von kranken Menschen nicht mehr so gut Fette verbrennen können. Dafür produzierten sie vermehrt Immunbotenstoffe. «Diese lösen im Viszeralfett von Menschen mit Übergewicht eine Immunreaktion aus», erklärt Reinisch. «Es ist denkbar, dass dies die Entstehung von Stoffwechselerkrankungen begünstigt.»
Sehr deutliche Unterschiede fanden die Forschenden ausserdem in der Anzahl und der Funktion der Mesothelzellen: Gesunde Übergewichtige haben in ihrem Viszeralfett anteilmässig viel mehr Mesothelzellen, und diese Zellen sind bei ihnen funktionell flexibler: Sie können bei gesunden Personen in eine Art Stammzell-Modus wechseln und sich so in einen anderen Zelltyp verwandeln, zum Beispiel in Fettzellen. «Dass sich ausdifferenzierte Körperzellen in Stammzellen verwandeln können, ist sonst vor allem von Krebs bekannt», sagt Reinisch. Daher war sie überrascht, dies auch im Fettgewebe zu finden. «Wir vermuten, dass die flexiblen Zellen am Rand des Fettgewebes bei gesunden Übergewichtigen eine unproblematische Ausdehnung des Gewebes ermöglichen.»
Schliesslich fanden die Wissenschaftler:innen auch Unterschiede zwischen Frauen und Männern: Ein bestimmter Typ von Vorläuferzellen ist nur im Viszeralfett von Frauen vorhanden. «Dies könnte Unterschiede in der Entstehung von Stoffwechselerkrankungen zwischen Männern und Frauen erklären», sagt Reinisch.
Neue Biomarker finden
Der neue Atlas zur Genaktivität von übergewichtigen Menschen beschreibt die Zusammensetzung der Zelltypen im Fettgewebe und ihre Funktion. «Wir können aber nicht sagen, ob die Unterschiede der Grund dafür sind, dass jemand metabolisch gesund ist, oder ob umgekehrt Stoffwechselerkrankungen diese Unterschiede verursachen», sagt Ghosh. Die Wissenschaftler:innen sehen ihre Arbeit vielmehr als Grundlage für weitere Forschung. Sie veröffentlichten alle Daten in einer öffentlich zugänglichen Web-App, damit andere Forschende damit arbeiten können.
Insbesondere lassen sich damit nun neue Marker finden, die eine Aussage über das Risiko erlauben, eine Stoffwechselkrankheit zu entwickeln. Auch die ETH-Forschenden suchen derzeit nach solchen Markern. Diese könnten auch zur Verbesserung der Therapie von Stoffwechselerkrankungen beitragen. So gibt es eine neue Klasse von Medikamenten, die den Appetit hemmen und in der Bauchspeicheldrüse die Insulinausschüttung fördern. Jedoch sind diese Medikamente knapp. «Biomarker, die sich aus unseren Daten ableiten lassen, könnten helfen, jene Patienten zu finden, die eine solche Therapie am meisten benötigen», sagt Reinisch.
Literaturhinweis
Reinisch I, Ghosh A, Noé F, Sun W, Dong H, Leary P, Dietrich A, Hoffmann A, Blüher M, Wolfrum C: Unveiling adipose populations linked to metabolic health in obesity. Cell Metabolism 2025, 37: 1, doi: externe Seite10.1016/j.cmet.2024.11.006