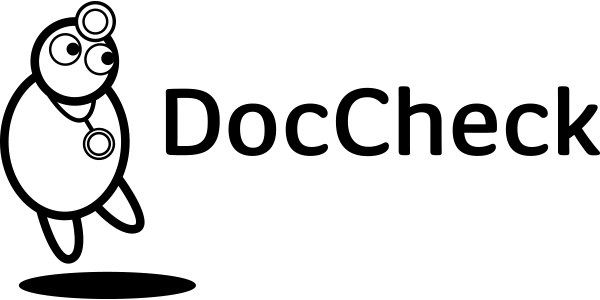Hepatitis D: Wenn das Immunsystem aus dem Ruder läuft
Eine Infektion mit Hepatitis D-Viren verursacht heftige Leberentzündungen. Ein MHH-Team hat jetzt einen Marker auf natürlichen Killerzellen identifiziert, der von der entzündungshemmenden Wirksamkeit des Medikaments Bulevirtid beeinflusst wird.
Hepatitis D-Viren (HDV) verursachen die schwerste Form unter den chronischen, virusbedingten Hepatitis-Erkrankungen. Seit Mitte 2023 ist der Wirkstoff Bulevirtid auf dem europäischen Markt als bislang einzige zugelassene Therapiemöglichkeit. Das Medikament heftet sich an die Bindungsstelle, die den Andockpunkt für die Virushüllen an der Leberzelle blockiert. Da dieser nun besetzt ist, können die HD-Viren nicht mehr in die Zelle gelangen. Gleichzeitig lindert Bulevirtid die Leberentzündung bereits früh während der Behandlung, wenn die Viruslast noch relativ hoch ist. Forschende der Klinik für Gastroenterologie Hepatologie, Infektiologie und Endokrinologie der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) haben nun untersucht, wie Bulevirtid das Immunsystem beeinflusst. Das Team um Dr. Norman Woller und Klinikdirektor Professor Dr. Heiner Wedemeyer hat entdeckt, das Natürliche Killerzellen (NK-Zellen) dabei eine wichtige Rolle spielen. Die Ergebnisse sind in der Fachzeitschrift „Hepatology“ veröffentlicht.
Doppelinfektion verursacht „Feuer in der Leber“
HDV ist ein sogenanntes unvollständiges Virus und benötigt das Hepatitis B-Virus (HBV) als Helfer, um sein RNA-Erbmaterial in dessen Hülle zu verpacken, an die Leberzelle anzudocken und in sie einzudringen. Eine Hepatitis D-Infektion kommt daher auch nur als Co-Infektion mit einer Hepatitis B-Infektion vor. „Hepatitis D verstärkt die bereits bestehende HBV-Infektion noch und verursacht sozusagen ein Feuer in der Leber“, sagt Dr. Woller. Hepatitis D ist zwar eine seltene Erkrankung, die weltweit etwa zehn bis 20 Millionen Menschen betrifft. Das Virus gilt jedoch als besonders aggressiv und kann schnell zu einer Leberzirrhose oder zu Leberkrebs führen, weshalb in der Medizin auch von der „Devil-Variante“ die Rede ist.
Das Forschungsteam hat das Immunsystem von Erkrankten untersucht, die an chronischer Hepatitis D (CHD) leiden und mit Bulevirtid behandelt wurden. „Die Kohorte von 20 Hepatitis D-Fällen bestand ausschließlich aus Patientinnen und Patienten der MHH“, betont Professor Wedemeyer, der die klinische Entwicklung des Medikaments geleitet hat. „Das ist bei einer so seltenen Erkrankung eine ungewöhnlich hohe Fallzahl für eine einzelne Klinik und liegt daran, dass wir an schon seit langem mit Einverständnis der Betroffenen Blutproben vor, während und nach der Behandlung sammeln und zu Forschungszwecken nutzen.“
Veränderter Marker auf Immunzellen
Die Forschenden richteten ihren Blick dabei auf das angeborene Immunsystem, insbesondere die natürlichen Killerzellen (NK). Diese Immunzellen sind sozusagen unsere erste Verteidigungslinie und richten sich vor allem gegen von Viren befallene Zellen und gegen Krebs. Wir haben vermutet, dass die BLV-Behandlung die Immunzellen bei CHD-Patienten beeinflussen könnte, und eine hochauflösende Analyse der NK-Zellen vor und während der BLV-Therapie vorgenommen“, sagt Dr. Norman Woller. Während die Anzahl der NK-Zellen selbst während der BLV-Behandlung insgesamt stabil blieb, konnten die Forschenden bei einer bestimmten CHD-Gruppe vor und während der Therapie deutliche Veränderungen bei einem für die Immunreaktion wichtigen Marker namens TIGIT auf der Oberfläche der NK-Zellen.
TIGIT gehört zu den sogenannten Immuncheckpoint-Proteinen, die vielversprechende Ansätze für die Krebstherapie bieten. Krebszellen können nämlich zusammen mit Zellen aus der unmittelbaren Tumorumgebung die Immunantwort unterdrücken. Dabei spielt der TIGIT-Signalweg eine wichtige Rolle. Der Immunrezeptor TIGIT befindet sich auf verschiedenen Immunzellsorten und wirkt dabei sozusagen als Bremse, um überschießende Entzündungsreaktionen zu verhindern. „Fehlt TIGIT oder ist der Checkpoint ausgeschaltet, läuft die eigentlich gewünschte Entzündungsreaktion des Immunsystems sozusagen aus dem Ruder“, erklärt Po-Chun Chen, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Klinik und Erstautor der Studie.
Bulevirtid schaltet NK-Zell-Bremse wieder an
Im Verlauf der Behandlung mit Bulevirtid stiegt die Aktivierung von TIGIT deutlich an. Gleichzeitig sanken die Werte des Enzyms Alanin-Aminotransferase, einem Marker für Leberentzündung. In den Kontrollgruppen aus Patientinnen und Patienten mit chronischer Hepatitis C sowie chronischer Hepatitis B war das nicht der Fall. „Das Fehlen der TIGIT-Aktivität auf bestimmten NK-Zellen ist offenbar ein Kennzeichen für eine Leberentzündung bei einer HDV-Infektion“, vermutet Dr. Woller. Eine Behandlung mit Bulevirtid schaltet die Bremse für die Entzündungsreaktionen möglicherweise wieder an und könnte somit der Auslöser sein, warum die Leberentzündung zurückgeht und sich die Leberenzyme während der Therapie schnell verbessern. „Die Aufklärung des Einflusses von Bulevirtid auf den TIGIT-Signalweg könnte helfen, neue Medikamente gegen Leberentzündungen zu entwickeln“, hofft der Biochemiker.
SERVICE:
Eine Zusammenfassung der Originalarbeit „TIGIT-expression on natural killer cell subsets is an early indicator of alleviating liver inflammation following bulevirtide treatment in chronic hepatitis D” finden Sie unter: https://journals.lww.com/hep/abstract/9900/tigit_expression_on_natural_killer_ce…
Eine Zusammenfassung der Zulassungsstudie für das Medikament Bulevirtide „A Phase 3, Randomized Trial of Bulevirtide in Chronic Hepatitis D“ finden Sie unter: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2213429#summary-abstract