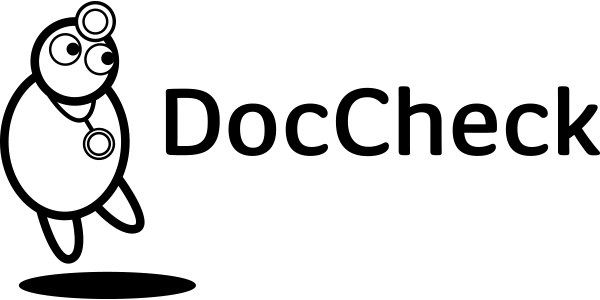Studie an der UMG untersucht neue Methodik zur Verbesserung der Gedächtnisleistung im Alter
Kooperationsprojekt unter Beteiligung der Klinik für Neurologie der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) untersucht den Einfluss neuer Behandlungsmethoden auf die Wahrnehmungs- und Denkprozesse älterer Menschen. Ziel ist es, ein Trainingsprogramm zu entwickeln, das eine gezielte Gehirnstimulation mittels elektrischer Ströme und eine neuartige Technologie basierend auf virtueller Realität kombiniert, um die Gedächtnisleistung im Alter zu verbessern. Die Forschungsstudie zur Überprüfung dieses innovativen Verfahrens wird an der UMG durchgeführt. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) fördert das dreijährige NeuroVR-Plus-Projekt mit insgesamt 800.000 Euro.
Kognitive Fähigkeiten wie beispielsweise Aufmerksamkeit, Erinnerungsvermögen und Lernfähigkeit nehmen mit zunehmendem Alter ab und führen in vielen Fällen zu Einschränkungen im alltäglichen Leben. Übersteigen diese kognitiven Verluste ein für das jeweilige Alter gesundes Maß, wird eine leichte kognitive Beeinträchtigung (mild cognitive impairment – MCI) diagnostiziert, welche als Vorstufe von Demenz gilt. Aufgrund einer immer älter werdenden Bevölkerung ist ein Anstieg an Demenzdiagnosen zu erwarten.
In einem Kooperationsprojekt untersuchen Prof. Dr. Andrea Antal, Leiterin der Arbeitsgruppe „Non-invasive Brain Stimulation Lab“ (NBSLab) in der Klinik für Neurologie der Universitätsmedizin Göttingen (UMG), und Dr. Lukas Diedrich, wissenschaftlicher Mitarbeiter im NBSLab, zusammen mit der VRalive GmbH in Braunschweig den Einfluss neuer Behandlungsmethoden auf die Wahrnehmungs- und Denkprozesse älterer Menschen. Ziel ist es, ein Trainingsprogramm zu entwickeln, das die Gedächtnisleistung im Alter verbessert. Dazu soll die Methode der transkraniellen elektrischen Stimulation, eine gezielte Gehirnstimulation mittels schwacher elektrischer Ströme, die durch den Schädel (transkraniell) und die Kopfhaut geleitet werden, mit einem kognitiven Training basierend auf virtueller Realität (VR) kombiniert werden. Die Teilnehmenden tragen während der Elektrostimulation eine VR-Brille und absolvieren damit ein kognitives Training. Zusätzlich ermöglicht ein in der VR-Brille integrierter Eyetracker die Messung von Pupillenveränderungen, die Aufschluss über den Grad der kognitiven Beanspruchung geben. Das bedeutet: Sind die Probanden überfordert, wird das Training einfacher, sind sie unterfordert, wird es schwerer. Das NeuroVR-Plus-Projekt wird mit insgesamt 800.000 Euro vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) über einen Zeitraum von drei Jahren gefördert.
Im Rahmen des Projekts wird eine Studie mit gesunden Proband*innen im Alter von 60 bis 85 Jahren unter Leitung von Prof. Dr. Andrea Antal diese innovative Methodik jetzt auf ihre Wirksamkeit hin überprüfen. „Die Kombination von transkranieller Gehirnstimulation mit einem kognitiven Training am Computer oder mit einem Tablet, hat in unserer vorherigen Studie bereits gute Erfolge erzielt“, sagt Prof. Antal. „Das Training nun in einer virtuellen Realität umzusetzen, bietet die Vorteile, dass die Teilnehmenden ihre kognitiven Leistungen in simulierten Alltagssituationen, wie zum Beispiel beim Blumen gießen im Garten oder beim Auffinden abgelegter Gegenstände in häuslicher Umgebung, trainieren können. Zudem können wir die Intensität des Trainings in Echtzeit an die individuelle kognitive Belastung anpassen, wodurch wir uns eine gesteigerte Wirksamkeit erhoffen“, ergänzt Dr. Lukas Diedrich.
Die Methoden: transkranielle elektrische Stimulation und kognitives Training
Bei der transkraniellen elektrischen Stimulation handelt es sich um ein Verfahren, bei dem ein schwacher Gleich- oder Wechselstrom durch die Kopfhaut und den Schädel (transkraniell) fließt und die Erregbarkeit der Nervenzellen beeinflusst. Durch gezielte Auswahl der Stimulationsparameter wie zum Beispiel Stromstärke und -dauer sowie einer exakten Positionierung der Elektroden, über die der Strom in den Kopf geleitet wird, lassen sich bestimmte Gehirnareale stimulieren. Dies kann eine positive Auswirkung auf verschiedene kognitive Fähigkeiten haben. Das Arbeitsgedächtnis beispielsweise speichert als Teil des Gedächtnisses aufgenommene Informationen kurzfristig ab, um diese in das Langzeitgedächtnis zu überführen. Eine Stimulation des Frontallappens des Gehirns, welcher eine zentrale Rolle im Arbeitsgedächtnis spielt, kann dazu führen, dass die kurzfristige Speicherung dieser Informationen verbessert wird und dadurch auch die Aufnahme in das Langzeitgedächtnis. Dies wurde bereits in zahlreichen Studien bewiesen. Vorteile bietet diese Behandlungsmethode dadurch, dass die Elektroden außen an der Kopfhaut ohne operativen Eingriff angebracht werden und in den meisten Fällen nur geringe Nebenwirkungen in Form eines leichten Kribbelns während der Stimulation auftreten, was auf die Verwendung sehr geringer Ströme (1-2 Milliampere) zurückzuführen ist.
Ein mehrtägiges kognitives Training bietet darüber hinaus die Möglichkeit einer Verbesserung bestimmter kognitiver Funktionen wie Schnelligkeit, Erinnerungsvermögen und Konzentration, welches ebenfalls bereits in vielen Studien nachgewiesen werden konnte.
Die Vorbereitungen zur NeuroVR-Plus-Studie laufen in Göttingen bereits seit einigen Monaten und die ersten Proband*innen werden im Februar 2025 rekrutiert.
Weitere Informationen zur Studie: https://www.drks.de/search/de/trial/DRKS00035235