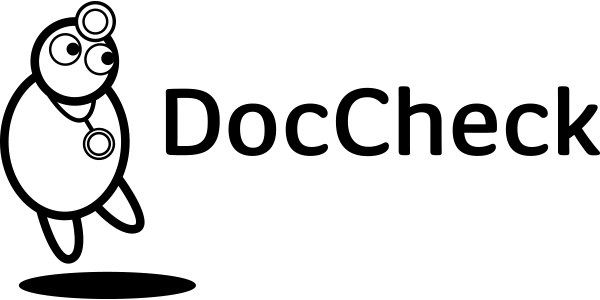Neue Studien zu Multiple Sklerose
Was sind Risikofaktoren für sexuelle Probleme bei MS und welche Patienten sollten häufiger auch auf solche Probleme hin angesprochen werden? Dies analysierten Experten in Österreich mit 152 Personen mit MS. Sowohl körperliche, neuro-urologische als auch psychosoziale Faktoren trugen demnach bei 47 % der Befragten zu Problemen bei. Das Thema sollte stärker in MS-Praxen angesprochen werden, schließen die Autoren.
Weiter zum ausführlichen Bericht →
Eine Netzwerk-Metaanalyse über 56 Studien und fast 30 000 MS-Patienten zeigte keinen Zusammenhang zwischen Risikoverhältnis für Krampfanfälle und krankheitsmodifizierender Therapie.
Weiter zum ausführlichen Bericht →
Bei Multipler Sklerose kommt es zu einer Vielzahl neurologischer Symptome, wie Fatigue, Schmerzen oder Spastizität, die die Lebensqualität stark einschränken. Zur Symptomlinderung wird nicht-invasive Gehirnstimulation als Behandlungsoption diskutiert. Eine Netzwerk-Metaanalyse zeigte nun, dass transkranielle Magnetstimulation und transkranielle elektrische Stimulation eventuell Symptom-lindernd eingesetzt werden können. Allerdings ist die bisherige Studienlage methodisch nicht überzeugend, so das Fazit.
Weiter zum ausführlichen Bericht →
Schlaf gilt in jungen Jahren als wesentlich für die Entwicklung des Immunsystems und könnte somit auch für Autoimmunerkrankungen wie MS bedeutsam sein. Schwedische Wissenschaftler zeigten nun in einer Fall-Kontroll-Studie, dass geringe Schlafdauer und -qualität in der Jugend das Risiko für MS erhöhen.
Weiter zum ausführlichen Bericht →
In einer Doppelblindstudie mit Placebokontrolle bei RRMS-Patienten mit niedrigen Vitamin D-Konzentrationen wurde zu Interferon beta-1a ergänzend Vitamin D über 96 Wochen mit Placebo verglichen. Läsionen im MRT und Rückfallrate deuteten, trotz nicht-erreichtem primärem Behandlungsziel, auf einen möglichen therapeutischen Effekt des Vitamin D und stützen weitere Untersuchungen.
Weiter zum ausführlichen Bericht →
Behandlungen der Multiplen Sklerose (MS) erfolgen in festen Abständen, um eine stabile Situation zu schaffen und so mögliche Rückfälle weitgehend zu verhindern. Ob eine stabile Behandlung mit Natalizumab abhängig von der individuellen Wirkstoffkonzentration auch ausgedehnt erfolgen kann, ermittelte nun eine prospektive Multizentrenstudie. Längere, individuell bestimmte Therapieabstände (5 – 7 Wochen) bei enger Kontrolle mit MRT und Rückfall-Assessment führten demnach nicht zu aufflammender Krankheitsaktivität.
Weiter zum ausführlichen Bericht →
Multiple Sklerose
Themenschwerpunkte
Eine schwedische Kohortenstudie untersuchte das Behandlungsmuster für Spastizität bei Multipler Sklerose anhand des Beispiels von oralem Baclofen. Mit über 5 000 Neudiagnosen oder bestehenden MS-Diagnosen zeigte sich ein häufiger, mit dem Behinderungsgrad steigender Bedarf, jedoch auch eine hohe Abbruchquote der Therapien.
Weiter zum ausführlichen Bericht →
Amerikanische Wissenschaftler analysierten in zwei USA-weiten Online-Umfragen, wie viele Befragte dem Arzt etwas medizinisch Relevantes verheimlichten. Thema war meistens die eigene Meinung zur ärztlichen Entscheidung oder Verständnisfragen. Typischerweise wurde dies verheimlicht, um Belehrungen und Vorhaltungen zu vermeiden. Offenbar besteht also Verbesserungsbedarf bei der Kommunikation zwischen Arzt und Patienten, die schließlich als ‚Team Gesundheit‘ für beste Behandlungsergebnisse eng und vertrauensvoll zusammenarbeiten sollten.
Weiter zum ausführlichen Bericht →
In einer Querschnittstudie ermittelten Forscher mit 351 Patienten den Einfluss von Alkoholkonsum und Zigarettenrauch auf den Schweregrad der Multiplen Sklerose (MS). Demnach waren Raucher häufiger und viel schwerer von der MS betroffen als Nichtraucher.
Weiter zum ausführlichen Bericht →
Literatur-Newsletter-Anmeldung
Medical NEWS Report
Hier können Sie sich für unseren Literatur-Newsletter anmelden. →
Im Leben mit Multipler Sklerose gibt es Vieles zu organisieren, an die jeweilige gesundheitliche Situation anzupassen und mit der notwendigen MS-Therapie in Einklang zu bringen. Die perfekte Figur steht da meist nicht im Vordergrund.
Weiter zum ausführlichen Bericht →
Was ist das beste Vorgehen bei der Behandlung von Multipler Sklerose: Eine frühe Therapie mit hochwirksamen Medikamenten oder erst einmal mit „sanfteren“ Medikamenten starten und wenn nötig auf wirksamere Therapien umsteigen?
Weiter zum ausführlichen Bericht →
Für die frühe Therapie der schubförmigen Multiplen Sklerose gibt es bisher wenig Studien, die unter realistischen Bedingungen Rituximab mit anderen Wirkstoffen vergleicht. Rituximab ist ein Antikörper, der sich gegen die B-Zellen des Immunsystems richtet. Schwedische Forscher sehen die Möglichkeit der Erstlinientherapie mit Rituximab.
Weiter zum ausführlichen Bericht →
Nach dem Auftreten einer sehr seltenen Krebserkrankung unter der Behandlung mit Natalizumab haben Forscher Berichte zu solchen Fällen aus den USA ausgewertet. Sie mahnen zur Wachsamkeit und fordern, weitere Punkte ins Sicherheitsüberwachungsprogramm aufzunehmen.
Weiter zum ausführlichen Bericht →
Neue Meldungen aus Instituten und Kliniken
Das Hormon löst bei Fettleibigkeit Insulinresistenz in den Zellen von Blutgefäßen aus
Ein Großteil der rund sechs Millionen Patienten mit Typ.2-Diabetes in Deutschland ist übergewichtig. Die Wirkung von Insulin ist bei ihnen eingeschränkt. Forschende v…
Weiter zur kompletten Gesundheitsnachricht →
Mathematisches Modell zeigt, wie das Gehirn sensorische Reize verarbeitet
Warum können wir uns nicht selbst kitzeln? Warum nehmen wir unsere eigenen Schritte anders wahr als die eines Fremden, der hinter uns läuft? Ein interdisziplinäres Forschungsteam…
Weiter zur kompletten Gesundheitsnachricht →
Um die Effektivität öffentlicher Videokampagnen gegen riskanten Alkoholkonsum zu bewerten, untersuchten PsychologInnen des Konstanzer Exzellenzclusters „Kollektives Verhalten“ die Synchronisierung der Hirnaktivitäten von Zuschauergruppen mittels EEG-Me…
Weiter zur kompletten Gesundheitsnachricht →
Mukoviszidose schädigt das Immunsystem früh
Trotz neuer Medikamente kommt es bei Mukoviszidose, auch als zystische Fibrose bekannt, häufig zu bleibenden Lungenschäden. Ein Team um Forschende der Technischen Universität München (TUM) hat jetzt herausgef…
Weiter zur kompletten Gesundheitsnachricht →
Mehr Komfort für Schwerkranke: MHH-Strahlentherapie arbeitet mit drehbarem Tisch.
Für Menschen mit Leukämien ist eine Knochenmark- oder Blutstammzelltransplantation häufig die einzige Überlebenschance. Für den Erfolg einer solchen Transplantation ist d…
Weiter zur kompletten Gesundheitsnachricht →
Frauenherzen schlagen anders: Unterschiede bei Warnzeichen und Risikofaktoren für Herzerkrankungen zu wissen, kann die Lebensqualität verbessern oder gar Leben von Frauen retten. Darüber informiert die Herzstiftung auch mit dem Comic „Frauenherzen im F…
Weiter zur kompletten Gesundheitsnachricht →
Brustschmerzen gehören zu den häufigsten Beratungsanlässen in der hausärztlichen Praxis. Die Gründe sind äußerst vielfältig – der oft befürchtete Herzinfarkt ist eher selten die Ursache. Trotzdem ist es wichtig, sich schnell orientieren und gefährliche…
Weiter zur kompletten Gesundheitsnachricht →
Hausbesuchsprogramme schützen langfristig – das zeigt eine aktuelle Veröffentlichung des Leibniz-Instituts für Präventionsforschung und Epidemiologie – BIPS. Als besonders wirksam erwies sich eine bestimmte Form der Betreuung.
Junge Mütter, die sich in…
Weiter zur kompletten Gesundheitsnachricht →
Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Biofeedback (DGBfb e.V.) zum Artikel im Deutschen Ärzteblatt vom 14.01.2025: “Kaum Belege für einen Nutzen von Neurofeedback-Behandlungen bei ADHS“
Mit Interesse haben wir, der Vorstand der Deutschen Gesells…
Weiter zur kompletten Gesundheitsnachricht →
Depressionen betreffen 280 Millionen Menschen weltweit. Eine Depressionserkrankung führt erwiesenermaßen zu verändertem Essverhalten. Forschende des Universitätsklinikums Bonn (UKB) und der Universität Bonn sowie des Universitätsklinikums Tübingen habe…
Weiter zur kompletten Gesundheitsnachricht →
Körpergewicht und Body-Mass-Index alleine sagen zu wenig darüber aus, ob jemand an Stoffwechselstörungen erkranken wird. Ein neuer Atlas über Zellen im Fettgewebe könnte nun helfen zu entschlüsseln, warum manche übergewichtigen Menschen gesund bleiben …
Weiter zur kompletten Gesundheitsnachricht →
Patientinnen und Patienten, deren Nieren nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr funktionieren, haben ein stark erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie zum Beispiel Schlaganfall oder Herzinfarkt. Eine Forschungsgruppe um PD Dr. Dalia Ala…
Weiter zur kompletten Gesundheitsnachricht →
Antibiotika sind unverzichtbar bei der Behandlung bakterieller Infektionen. Doch warum sind sie manchmal unwirksam, selbst wenn die Bakterien nicht resistent sind? In ihrer aktuellen Studie in der Fachzeitschrift «Nature» widerlegen Forschende der Univ…
Weiter zur kompletten Gesundheitsnachricht →